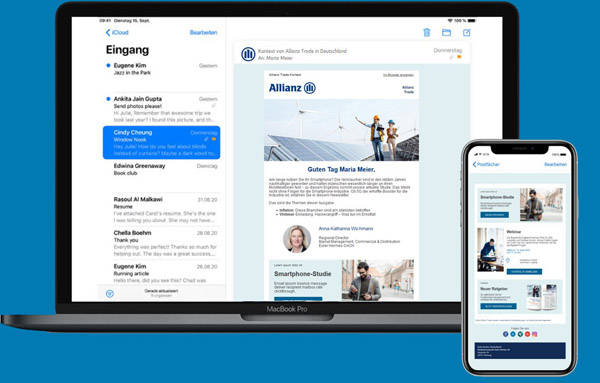Der weltweite Druck zur Reduzierung der CO2-Emissionen und zur Elektrifizierung unserer Wirtschaft ist der wichtigste Katalysator für Infrastrukturinvestitionen, die bis 2035 zwischen 26 und 30,2 Billionen US-Dollar (69 % der Gesamtinvestitionen) erreichen werden. Trotz einer Verdopplung der Investitionen in erneuerbare Energien in den letzten zehn Jahren hinkt die Entwicklung der Infrastruktur – wie Stromnetze und Speicher – hinterher, was zu Engpässen und steigenden Systemkosten führt. Allein in Europa werden jährlich schätzungsweise 110 bis 150 Mrd. USD für den Ausbau der Stromnetze und Energiespeicher benötigt, wobei die größten Investitionen in Verteilungs- und Übertragungsnetze sowie in länderübergreifende Verbindungen fließen werden.
Weltweit beträgt die jährliche Investitionslücke im Bereich der Energieinfrastruktur weiterhin 1,5 Billionen USD, wobei die Unterinvestitionen in den USA und den Schwellenländern besonders gravierend sind. Die Schließung dieser Lücke ist nicht nur für die Deckung des steigenden Strombedarfs unerlässlich, sondern auch für die Erreichung der Klimaziele und die Verbesserung der Energiesicherheit.
Vor diesem Hintergrund hat sich privates Kapital von einem Lückenfüller zum Eckpfeiler der globalen Infrastrukturfinanzierung entwickelt, wobei das verwaltete Vermögen an nicht börsennotierten Vermögenswerten von weniger als 25 Mrd. USD im Jahr 2005 auf über 1,5 Billionen USD im Jahr 2024 gestiegen ist. Investoren verlagern ihren Fokus von traditionellen Transport- und Versorgungsunternehmen hin zu Energieumstellung und digitalen Plattformen (Netze, Speicher, Rechenzentren, Glasfaser).
Über das Kapital hinaus bringt dieser Wandel Effizienz über den gesamten Lebenszyklus, Disziplin bei der Umsetzung und Risikoteilung durch öffentlich-private Partnerschaften, direkte Eigentümerschaft und einen schnell wachsenden Markt für private Infrastrukturkredite. Die Allokationen sind nun nach Risiko segmentiert und zielen eher auf stabile, inflationsgebundene Cashflows als auf private-equityähnliche Aufwärtspotenziale ab. Die meisten Anleger streben Renditen von 6 bis 10 % an, was unserer Prognose von 8 bis 10 % entspricht.
Die nächste Phase der globalen Infrastrukturinvestitionen muss sowohl von Ambitionen als auch von der Umsetzung geprägt sein. Die Mobilisierung von 3,5 % des globalen BIP pro Jahr ist zwar notwendig, aber nicht ausreichend. Jetzt kommt es darauf an, Kapital, Politik und Systemgestaltung aufeinander abzustimmen, um die realen Hindernisse zu überwinden, die die Umsetzung weiterhin verlangsamen.
Die Hindernisse sind zunehmend struktureller Natur und reichen von Verzögerungen bei der Genehmigung und Überlastung der Netze bis hin zu fragmentierten Regulierungsrahmen und institutionellen Kapazitätslücken in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert eine doppelte Umstellung. Erstens müssen die Regierungen Genehmigungen und Landnutzungsgenehmigungen beschleunigen, die Vergütungs- und Regulierungsrahmen zwischen den Rechtsordnungen harmonisieren und Schnellverfahren für vorrangige Infrastrukturprojekte einführen. Die Vereinfachung und Digitalisierung der Beschaffungsprozesse kann die Vorlaufzeiten verkürzen und die Transparenz verbessern. Die Verbesserung der Projektvorbereitungsmöglichkeiten und der technischen Hilfe, insbesondere in Regionen mit niedrigerem Einkommen, wird entscheidend sein, um Projekte von der Konzeption bis zur Bankfähigkeit zu bringen.
Ebenso wichtig ist die Stärkung der Kapazitäten subnationaler Behörden und staatlicher Unternehmen, die oft eine zentrale Rolle bei der Umsetzung spielen. Investoren müssen von breit angelegten Zuweisungen zu gezielteren, themenbezogenen Strategien übergehen, die sich auf Energiesysteme, digitale Infrastruktur, resiliente urbane Mobilität und soziale Infrastruktur konzentrieren, um resiliente, inflationsgebundene Renditen zu erzielen. Um in Regionen mit hohem Risiko Kapital in großem Umfang zu mobilisieren, ist auch ein verstärkter Einsatz von Mischfinanzierungen und Risikominderungsinstrumenten erforderlich. Ohne diese Abstimmung wird die Umsetzung weiterhin ein Engpass sein. Die Systemkosten werden steigen, gestrandete Vermögenswerte werden zunehmen und die Kluft zwischen Infrastrukturzielen und der tatsächlichen Umsetzung wird sich weiter vergrößern.